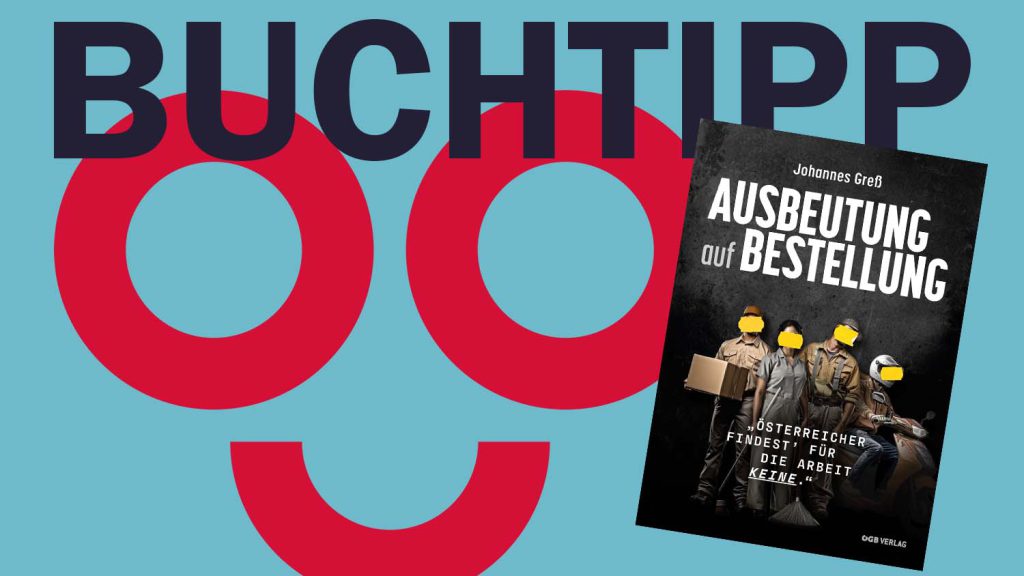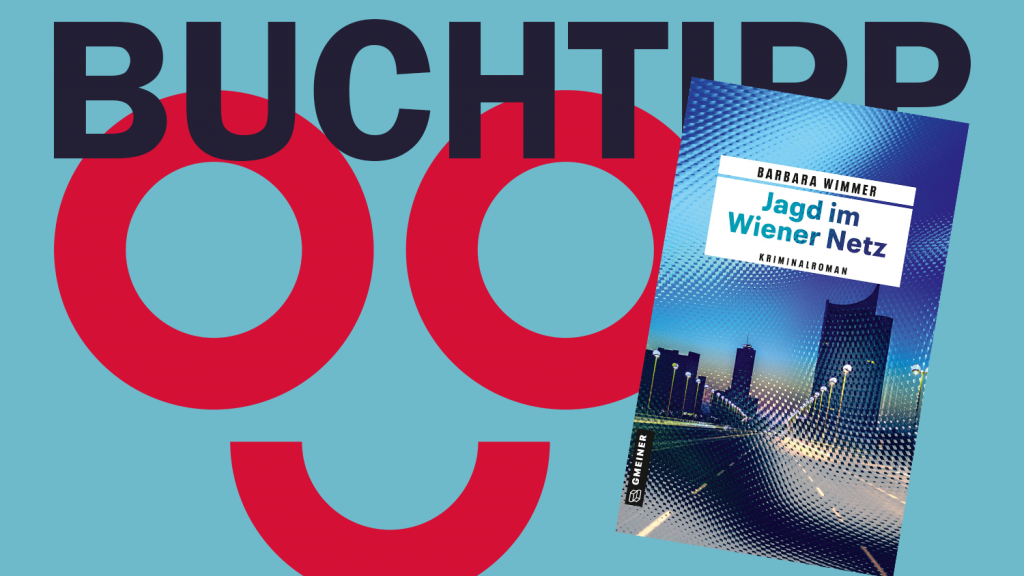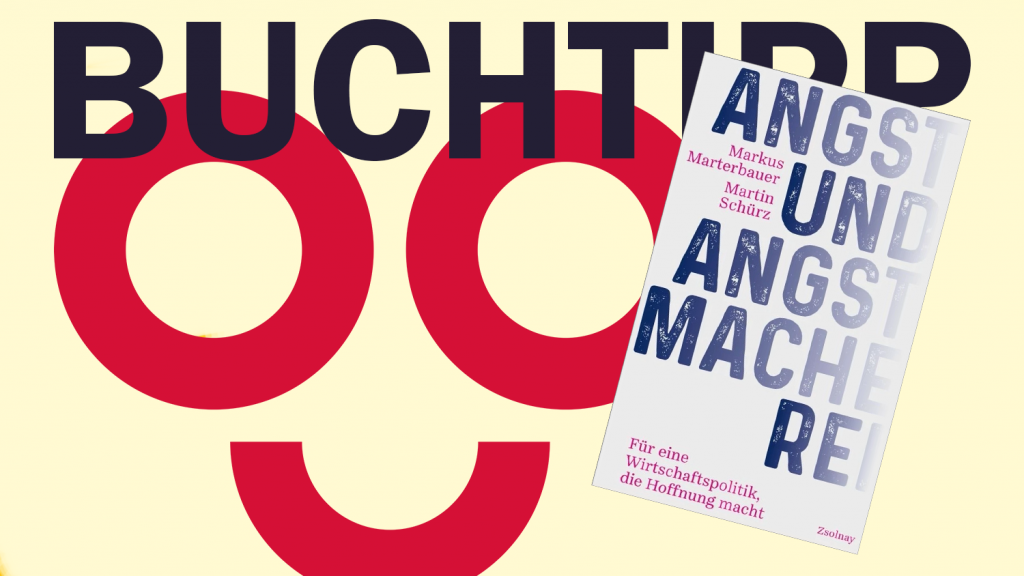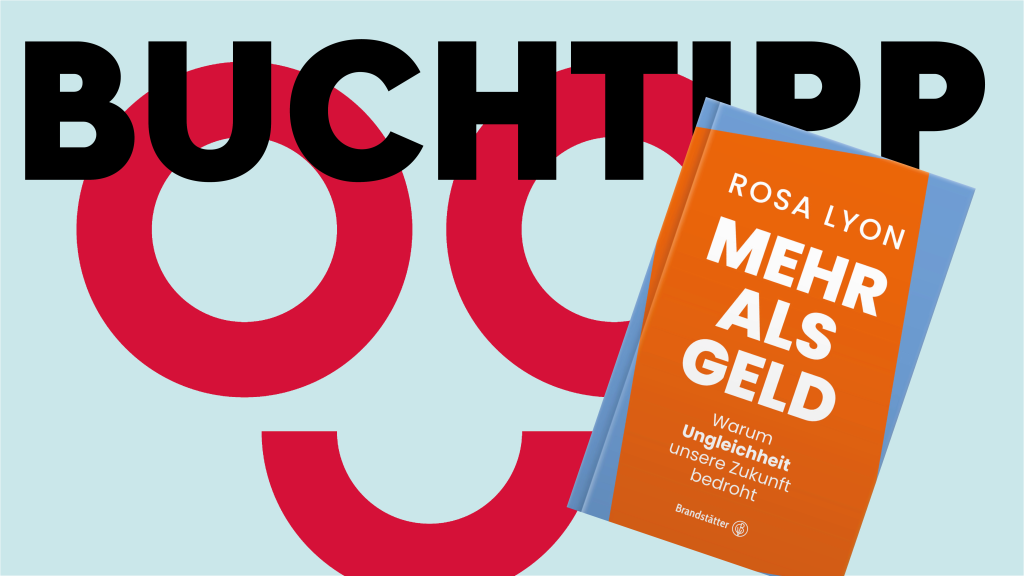
In ihrem eben erschienenen Buch „Mehr als Geld“ macht sich die Ökonomin und ORF-Journalistin Rosa Lyon auf die Suche, wie sich Ungleichheit zeigt. Sie zeigt dabei auf: Über Vermögen zu verfügen ist nur ein Steinchen des Mosaiks. Wie gut Menschen leben, hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Dabei spielt der Sozialstaat eine wichtige Rolle.
Reiche und arme Menschen in Karachi in Pakistan trennt etwas ganz Elementares: Wasser. Während in Pakistan wenige Familie reich und mächtig sind, sind Millionen von Menschen mittellos, schildert Lyon. In Karachi bedeutet das auch: etwa eine Million Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Es gibt zwar Wasserleitungen, aber aus dem Wasserhahn kommt trotzdem nichts. Eine Wassermafia zweigt das kostbare Nass aus den Hauptleitungen ab und verkauft es dann, je nach Qualität, zu hohen oder niedrigeren Preisen. Das günstigste Wasser macht allerdings krank. Die Menschen, die es kaufen, wissen das, sie können sich aber kein sauberes Wasser leisten. Die Superreichen wiederum können nur in „gated communities“ leben, sind in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und müssen hohe Summen für Sicherheit ausgeben. Der fehlende Sozialstaat bedeutet nicht nur fehlende Grundversorgung für die einen, sondern auch mehr Kriminalität und damit Unsicherheit für die anderen.
Sozialstaat wirkt ausgleichend
Der Verdienst von Lyons Buch: an Hand vieler verschiedener Beispiel wie diesem setzt sie unterschiedliche Phänomene zueinander in Beziehung und zeigt auf, dass sich Ungleichheit auf vielen Ebenen zeigen kann. In Deutschland und Österreich ist zum Beispiel die Vermögensungleichheit größer als in vielen südeuropäischen Ländern. „Es geht hierzulande deswegen jedoch nicht ungerechter zu.“ Hier spielt etwa der soziale Wohnbau eine Rolle. Aber auch die Sozialversicherung ist ein wesentlicher Faktor. „Der Sozialstaat sorgt für viele Risiken vor, für die andernfalls Vermögen privat gebildet werden müssten.“ Zu solchen Risiken gehören zum Beispiel auch Unfälle, Erkrankungen, nicht mehr arbeiten zu können.
Wenn Menschen in anderen Ländern also mehr Geld angespart haben, bedeutet das nicht, dass ihre Lebensqualität höher ist. „Mehr Geld auf einem Bankkonto bedeutet keine soziale und ökonomische Verbesserung, wenn es für eventuelle medizinische Eingriffe verwendet werden muss, da es keine staatliche Gesundheitsversicherung gibt.“ Ländervergleiche dieser Art würden daher wenig Sinn machen. Es müssten immer auch die institutionellen Rahmenbedingungen mitgedacht werden.
In Ländern mit umfangreichen Sozialleistungen und einem progressiven Steuersystem, wie etwa in Skandinavien, sei die gemessene Ungleichheit niedrig, da der Staat ausgleichend agiere. Lyons Fazit: „Nicht nur die Zahlen auf dem Bankkonto sind wichtig. Es ist erheblich, ob leistbare Mietwohnungen und gute Arbeit zu finden sind, man einen gepflegten Park vor der Haustür findet und rasch einen Arzttermin bekommt, wenn man ihn braucht. Ungleichheit ist mehr als Geld.“
Umverteilung nützt auch Wohlhabenden
Die Autorin zeigt allerdings auf, dass ausgleichendes Eingreifen des Staates auch bereits Wohlhabenden zu Gute kommen kann. In Österreich werde bei Umverteilung zunächst an Unterstützungsleistungen wie das Arbeitslosengeld gedacht. Der Staat greife aber laufend ein und verteile Steuergeld in Form von Förderungen oder Hilfen. „Öfter als gemeinhin angenommen geschieht diese Umverteilung von unten nach oben“, so die Autorin. „Wer beispielsweise eine Bank rettet, rettet Einlagen, Konten. Aktionär:innen und Anleihen-Besitzer:innen. Menschen, die derlei Kapitalvermögen besitzen, sind kein repräsentativer Durchschnitt einer Bevölkerung. Bankenrettung kann man also getrost Umverteilung nach oben nennen.“ Ein anderes Beispiel sei die Förderung von Elektroautos.
Und Lyon zeigt auch auf: Erben wird immer wichtiger. Das bereits erarbeitete Vermögen übertreffe mittlerweile um ein Vielfaches, was heute in einem Jahr von uns allen erarbeitet werde. Deshalb würden auch in Österreich und Deutschland die eigene Arbeit und die Ersparnisse daraus an Bedeutung für die Vermögensbildung verlieren. Relevanter sei hier, was vererbt und geerbt werde. „Zugespitzt formuliert: Arbeit lohnt sich immer weniger.“
Was Lyon mit ihrem Buch erreichen möchte, formuliert sie im Vorwort so: einen Raum zu bieten, die vielfältigen Perspektiven auf Ungleichheit zu verstehen und wissenschaftliche Erkenntnisse so darzustellen, dass sie die Tiefe und die Nuancen des Themas zeigen. Damit möchte sie eine Grundlage für eine reflektierte Diskussion bieten. Das ist ihr mit „Mehr als Geld“ gelungen. Einprägsame Beispiele, auch aus der Populärkultur, schaffen zudem einen leichten Zugang, auch sprachlich bemüht sie sich um gute Verständlichkeit. Am Ende weiß der Leser, die Leserin: Ungleichheit bedeutet in Europa etwas anderes als in einem Entwicklungsland, Ungleichheit muss nicht immer etwas Negatives bedeuten, aber eben auch: Ungleichheit lässt sich nicht nur finanziell bewerten, sondern bedeutet etwa auch, dass Bildung – wie in Österreich immer noch tendenziell der Fall – vererbt wird, Kinder von Akademiker:innen also eher auch selbst eine Universität besuchen werden als Söhne und Töchter von Pflichtschulabsolvent:innen.
Rosa Lyon: Mehr als Geld: Warum Ungleichheit unsere Zukunft bedroht
Verlag Brandstätter, Wien 2025, 176 Seiten, ISBN 978-3-7106-0857-5, 25 Euro