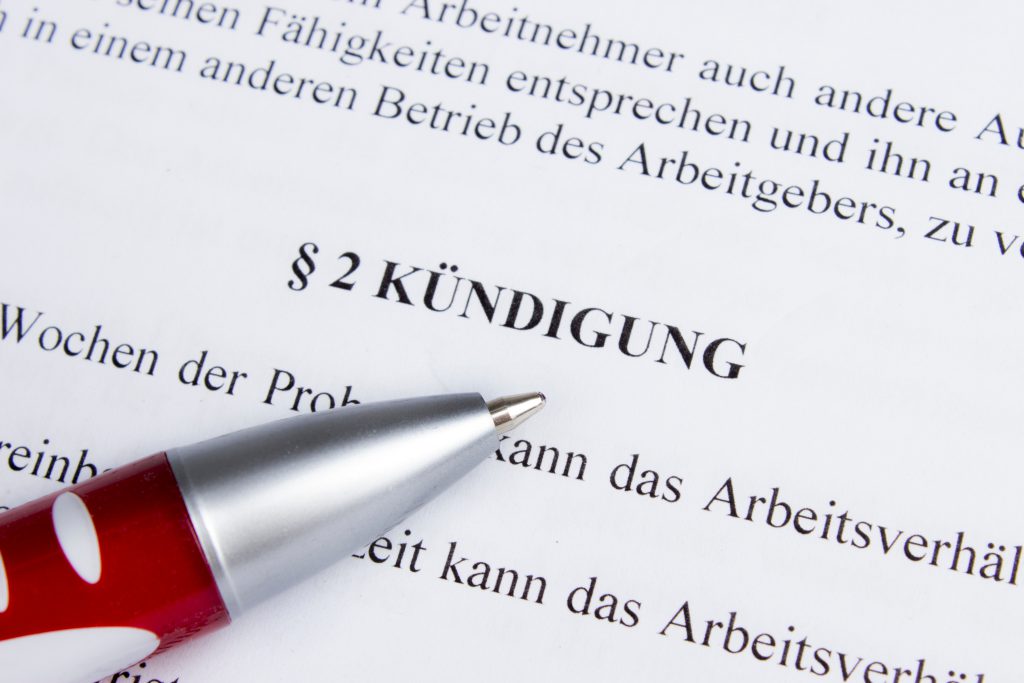© Tizian Rupp
Der Wissenschafter Stephan Pühringer hat sich angesehen, wie die Netzwerke von Superreichen aussehen. Dabei wurde etwa eine Person gefunden, die in 250 Unternehmen als Geschäftsführer tätig ist.
KOMPETENZ: Wie ungleich ist Österreich?
Stephan Pühringer: Im Bereich der Einkommen ist Österreich im internationalen Vergleich durch die progressive Einkommenssteuer gar nicht besonders ungleich. Das ist die eine Seite. Denn bei der Vermögensverteilung ist Österreich an der absoluten Spitze der Ungleichheit.
Das oberste Prozent besitzt ca. 40% des Vermögens, die oberen 10% haben 2/3 des Vermögens. Die unteren 50% haben circa 2-3% des Vermögens. Das ist wirklich extrem ungleich, auch im internationalen Vergleich. Ein Beispiel: Die Familie Porsche besitzt alleine so viel wie die untere Hälfte in Österreich. Eine Familie versus vier Millionen Menschen.
KOMPETENZ: Sie haben sich in einer Studie das Netzwerk von „Überreichen“ angesehen. Was ist da herausgekommen?
Stephan Pühringer: Wir haben eine Liste der reichsten Personen und Familien genommen und haben einen Cut bei einem Vermögen unter 500 Millionen Euro gemacht. Übrig blieben 62 Personen bzw. Haushalte. Im nächsten Schritt haben wir analysiert, welche Unternehmen sie besitzen und wie sie Einfluss auf Politik und Gesellschaft ausüben.
Aufbauend auf dieser Untersuchung haben wir uns Personen aus dem engeren Umfeld dieser Überreichen angesehen. Bei den 62 Haushalten sieht man dann recht schnell, wie sehr sie miteinander verflochten sind. Wobei gesagt werden muss: Diese Netzwerke bestehen nicht nur aus Überreichen, sondern auch aus einer Industrie von Vermögensverwalter:innen rund um sie.
„Privatstiftungen sind wirklich nur für die absolut Reichsten da. Die Gesellschaft hat davon meist nichts. “
Sozioökonom Stephan Pühringer
KOMPETENZ: Wie funktioniert Überreichtum nun?
Stephan Pühringer: Eine zentrale Erkenntnis ist, wie stark bestehende Rechtsrahmen im Sinne der Überrreichen ausgenutzt werden. Zum Beispiel bei Privatstiftungen: Es gibt ca. 3.000 Privatstiftungen in Österreich – in dem Netzwerk, das wir uns angesehen haben, sind ca. 40-50% aller Privatstiftungen verortet. Das heißt: Privatstiftungen sind wirklich nur für die absolut Reichsten da. Dazu kommt, dass Privatstiftungen in Österreich nicht einmal gemeinnützig sein müssen. Die Gesellschaft hat davon meist nichts.
Oder bei der Verschachtelung von Unternehmen. Es gibt in dem Netzwerk zum Beispiel eine Person, die in 250 Unternehmen als Geschäftsführer tätig ist. Da geht sich kein Tag in jeder Firma aus! Das macht keinen Sinn mehr! Man verwendet wieder einen Rechtsrahmen, in diesem Fall den der GmbH, um das eigene Risiko zu verkleinern. Die Folge ist, dass in letzter Konsequenz die Allgemeinheit die Kosten tragen muss, wenn mehrere dieser GmbHs insolvent werden.
„Man kann sich Überreichtum auch ökologisch nicht leisten.“
Stephan Pühringer
KOMPETENZ: Was bedeutet das unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit?
Stephan Pühringer: International verursachen die oberen 10% der Bevölkerung rund 50% der CO2-Emissionen. In Österreich emittieren die unteren Prozent CO2 für Dinge, die zum Überleben notwendig sind, zum Beispiel Essen oder Heizen. Die oberen Prozent aber für Dinge wie Privatjets, also für einen Lebensstil, der nicht auf das Überleben ausgerichtet ist.
Ein extremes Beispiel ist die private Raumfahrt: Der Treibstoffverbrauch für 15 Minuten Schwerelosigkeit im All für eine überreiche Person im Weltall ist ungefähr so viel wie die CO₂-Emissionen von Burundi – also von 11 Millionen Menschen! – an einem ganzen Tag ausgestoßen wird. Man kann sich Überreichtum also auch ökologisch nicht leisten.
KOMPETENZ: Erbt man sich reich in Österreich? Oder wird Vermögen eher erarbeitet?
Stephan Pühringer: Eine neue Schätzung zeigt, dass ca. 80% des Vermögens in Österreich vererbt wird. Das Narrativ lautet aber trotzdem, dass es sich um Self-Made Millionär:innen und Milliardär:innen handelt. Eine Erbschaftssteuer mit hohem Freibetrag würde das Haus der Oma oder eine kleine Firma nicht betreffen. Selbst wenn man eine Grenze von einer Million einziehen würde, wären rund 99 % aller Erbschaften überhaupt nicht steuerpflichtig! Dennoch würde zum Beispiel eine Erbschaftssteuer viel bringen, weil die Konzentration so schief ist.
Ein Rechenbeispiel: Hätte man theoretisch auf das gesamte Vermögen von Didi Mateschitz etwa eine Erbschaftssteuer von 5% angewendet, als dieses an seinen Sohn übergangen ist, wäre damit eine Kindersicherung in Österreich für ein Jahr durchfinanziert gewesen. Dazu kommt: Das hätte sich kaum auf das Vermögen von Mark Mateschitz ausgewirkt, da es sowieso so rasant wächst.
KOMPETENZ: Das heißt, in der Diskussion muss es nicht nur um Vermögenssteuern gehen?
Stephan Pühringer: Wir müssen darüber reden, wie viel Unterschied es in der Gesellschaft geben darf. Dahinter muss die Frage stehen, wie viel Geld ein Mensch wirklich haben muss. Das Bruttoinlandsprodukt Österreichs entspricht ungefähr dem Vermögen von Elon Musk. Da kann jemand noch so fleißig sein, aber das steht doch in keiner Relation!
Wenn unsere Studie nun zeigt, dass der Rechtsrahmen jene bevorzugt, die mehr besitzen, dann meinen wir nicht die Person, die eine Villa hat oder einen Porsche fährt. Es geht um eine völlig eigene Parallelwelt, die man sich kaum vorstellen kann. Und man muss sich als Gesellschaft schon die Frage stellen, ob wir uns diesen Überreichtum leisten wollen oder ob nicht etwa Care-Arbeit mehr wert sein sollte.
Zur Person
Stephan Pühringer ist Sozioökonom, stv. Leiter des Instituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) und Leiter des Socio-Ecological Transformation Labs am Linz Institute for Transformative Change (LIFT_C) an der Johannes Kepler Universität Linz.