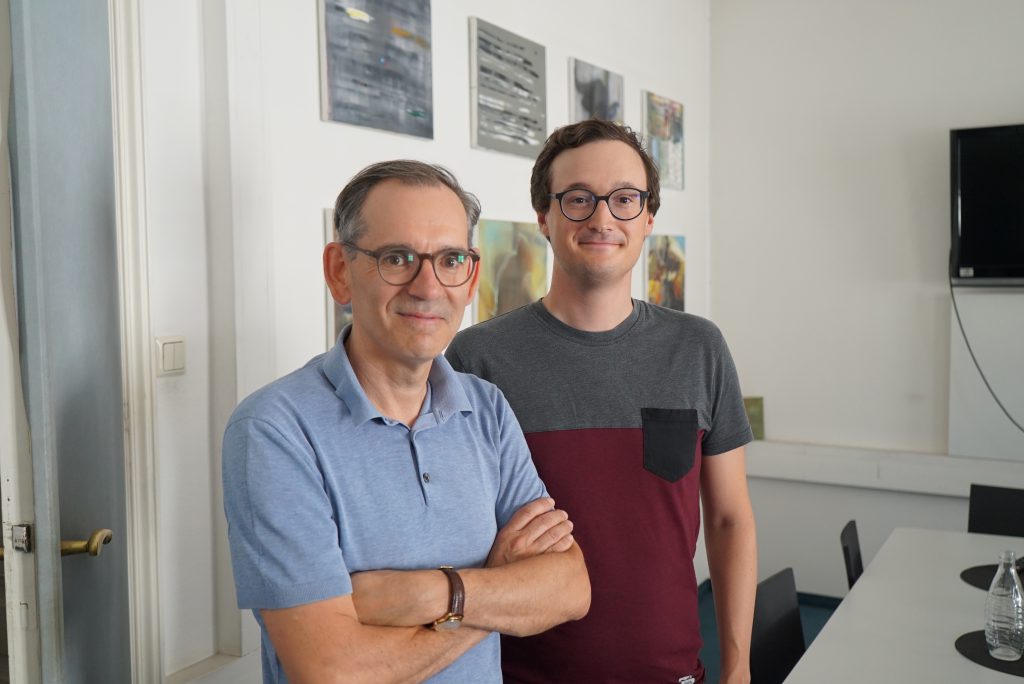
© Tizian Rupp
Ein europaweites Forschungsprojekt unter österreichischer Leitung fragt, wie sich Qualifizierungssysteme in Hinblick auf den Arbeitsmarkt ändern müssen. Was dabei nicht vergessen werden darf, sind die Arbeitsbedingungen.
KOMPETENZ: In Ihrem Forschungsprojekt beschäftigen Sie sich mit dem Phänomen des „Mismatch“. Was ist überhaupt ein Mismatch?
Markowitsch: Mismatch ist in der einfachsten Form das Missverhältnis von Arbeitskräften im Verhältnis zu ihrer Nachfrage durch den Markt. Doch so einfach ist es nicht, denn ich suche bei einer Stelle ja eine Person mit bestimmten Ausbildungen und Fähigkeiten. Und diese Anforderungen sind in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen.
Markowitsch: Während man einen Mismatch auf Ebene der Bildungsabschlüsse recht gut messen kann, indem man etwa die Stellen mit Voraussetzung Lehr-, Matura- oder Hochschulabschluss etc. betrachtet, ist das auf der Kompetenz-Ebene deutlich schwieriger. Dabei ist es gerade hier interessant, zu sehen, welche konkreten Fertigkeiten denn eigentlich gesucht werden.
KOMPETENZ: Hier fällt einem der oft ausgerufene Fachkräftemangel ein?
Markowitsch: Werden Unternehmen nach diesem Mangel befragt, so liegt deren Einschätzung überlicherweise deutlich über der tatsächlichen Situation am Arbeitsmarkt. Das liegt daran, dass Fragen der Arbeitsbedingungen in der Analyse gerne ausgeklammert werden. Fügt man aber etwa den Faktor der Bezahlung dazu, ist der Mismatch oft gar nicht so hoch. Hier fehlen nicht die Arbeitskräfte, sondern niedrig gehaltene Gehälter sind das Problem.
Dazu kommt, dass sich ein Mismatch oft auf vielen Ebenen abspielt: Jemand kann technisch zwar sehr kompetent sein, aber die nötigen Abschlüsse fehlen. Oder jemand hat zwar die Abschlüsse und ist hochkompetent, aber es fehlt die Sprachkenntnis. Oder man möchte Vollzeit arbeiten, angeboten wird aber nur eine Teilzeitstelle. Man kann sozusagen mehrfach “mismatchen”.
Wenn es dann von Seiten der Wirtschaft heißt, dass es nicht genug Fachkräfte vom Typ X gibt, ist das nur die halbe Wahrheit. Einerseits ist die Bezahlung zu niedrig, dann wäre der Mismatch kleiner. Andererseits gibt es wie geschildert noch viele weitere Faktoren, die zu einem Mismatch beitragen können.
KOMPETENZ: Wie unterscheidet sich das Projekt von bisherigen Ansätzen?
Markowitsch: Fast alle Arbeiten zu Fachkräften, Prognosen und auch die dazugehörige Politik basieren auf der Humankapital-Theorie. Diese sagt vereinfacht, dass Investment in Bildung entsprechenden wirtschaftlichen Fortschritt bringt. Davon sollen wiederum alle profitieren. Gleichzeitig sollen sich die Fachkräfte den Bedingungen des Arbeitsmarktes und der Unternehmen anpassen.
Unser Ansatz war, die Thematik aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und bei den Wünschen und Potentialen der Menschen anzusetzen. Wenn man das Fachkräftethema aus dieser Sicht betrachtet, stellen sich die Dinge sehr anders dar.
KOMPETENZ: Wie stellen sich die Dinge denn anders dar?
Markowitsch: Zum Beispiel bei der Evaluierung von Weiterbildungsprogrammen. Hier wird normalerweise darauf geachtet, ob und wie stark Arbeitgeber in die Programme eingebunden sind. Es wird aber nie danach gefragt, ob Arbeitnehmer:innen vertreten sind. Bringt man diese Position dann in die Bewertung ein, verändern sich die Ergebnisse – und ermöglichen so einen ganz anderen Blick auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Personen.
„Wir können uns nicht unendlich weiterbilden und unendlich viele Fähigkeiten erlernen. “
Arbeitsmarkt-Forscher Jörg-Markowitsch
KOMPETENZ: Was heißt das auf politischer Ebene?
Unterweger: Wir haben europaweit Strategiedokumente verglichen, ob sie nicht nur von Seiten des Wirtschaftsbedarfs gedacht werden, sondern Individuen auch Möglichkeiten bieten, selbstbestimmt ihre Fähigkeiten stärken. Zwar gibt es den Aspekt, den Spielraum des Individuums zu stärken, aber oft scheitert es bei der konkreten Umsetzung von Strategien und deren Maßnahmen
Was wir analysiert haben, ist, dass politische Strategiepapiere eher umgesetzt werden, wenn es ein partizipativer Prozess ist – zum Beispiel in Österreich und Deutschland durch Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Politik, wo Maßnahmen dann auch teilweise durch die Sozialpartner umgesetzt werden.
KOMPETENZ: Wie sieht das in der Praxis aus?
Unterweger: Ein positives Beispiel ist der Qualifikationsplan Wien, eine Strategie von der Stadt Wien, dem Bund und den Sozialpartnern, um gering qualifizierte Personen höher zu qualifizieren. Hier ist die Koordination zwischen den eingebundenen Akteuren, zu denen unter anderem der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammer zählen, sehr gut. Gleichzeitig ist das „Monitoring“ des Plans, mit der sein Erfolg gemessen wird, effektiv und nachhaltig – zeigen die Ergebnisse Handlungsbedarf, wird der Plan direkt angepasst.
Andersherum ist es in Ländern wie England, wo Sozialpartnerschaft so gut wie keine Rolle spielt. Diese werden nur pro Forma von der Politik in die Erstellung solcher Strategien eingebunden. Neue Regierungen fühlen sich dann zumeist überhaupt nicht an Vereinbarungen gebunden.
Die gestiegenen Anforderungen für Berufe setzen vor allem Leute mit niedrigem oder keinem Abschluss unter hohen Druck.
Arbeitsmarkt-Forscher Daniel Unterweger
KOMPETENZ: In welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft, wenn Bildung immer relevanter wird?
Markowitsch: Die gestiegenen Anforderungen für Berufe setzen vor allem Leute mit niedrigem oder keinem Abschluss unter hohen Druck. Statt dann nur auf Bildung zu setzen, wäre es genauso wichtig, sich konkrete Jobsituationen anzusehen und diese zu verbessern. Das beginnt schon bei der Jobstruktur: Nur weil mir entsprechende Qualifikationen für einen höheren Job fehlen, heißt das nicht, dass ich nur eine Tätigkeit in meiner Arbeit ausüben kann – auch wenn das oft genug der Fall ist.
Was uns als Gesellschaft sicher nicht weiterbringt, ist, das Fehlen von Bildung auf das Individuum abzuwälzen, nach dem Motto ‘jeder ist selber schuld’. Hier stößt auch die Humankapital-Theorie schnell an eine Grenze: Wir können uns nicht unendlich weiterbilden und unendlich viele Fähigkeiten erlernen. Den Glauben, alle Probleme mit Bildung lösen zu können, halte ich daher für falsch. Man muss auch über Arbeitsbedingungen und ihre Verbesserungen sprechen.
Unterweger: Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Weiterbildungen gerade auch diesen Personengruppen zu ermöglichen und auszubauen. Dazu gibt es in Österreich und Deutschland einige Projekte, die sehr praxisnah arbeiten.
Zu den Personen
Jörg Markowitsch forscht seit über 30 Jahren im Bereich Arbeitsmarkt, mit den Schwerpunkten Lebenslanges Lernen, Berufsbildung und Fachkräfteprognosen.
Daniel Unterweger ist Polit-Ökonom mit Schwerpunkt in der vergleichenden Analyse von Aus- und Weiterbildungssystemen.



