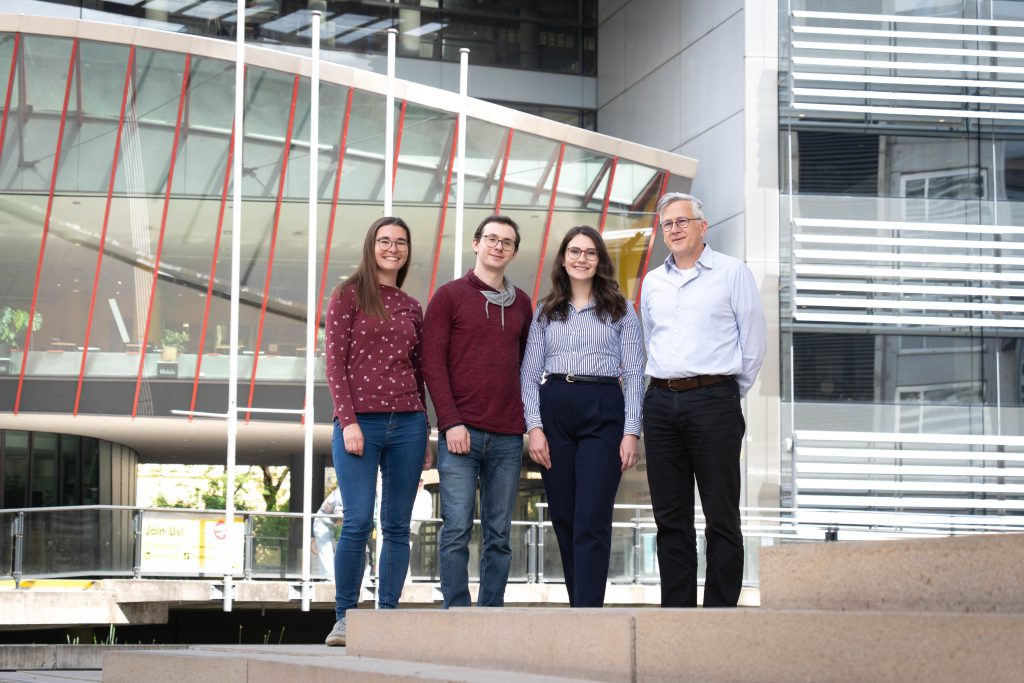Foto: Adobe Stock
Tech-Unternehmen wie Apple schrieben 2023 mehr als 3.000 Dollar Gewinn – pro Sekunde. Steuern zahlen Apple, Google, Facebook und Co. allerdings kaum. Wie lassen sich die Tech-Giganten fair besteuern?
Konzerne, die horrende Gewinne schreiben und dafür kaum Steuern bezahlen, weil sie ihr Geld in Steueroasen verschieben oder mit Staaten lukrative Steuerdeals abgeschlossen haben – leider haben wir uns an derlei Schlagzeilen längst gewöhnt. Staaten entgehen dadurch jährlich Milliarden.
Besonders ausgeprägt ist diese Problematik bei den sogenannten „Big 5“, also Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple und Microsoft. Sie werden oft unter dem Kürzel GAFAM zusammengefasst und die meisten von uns benutzen mehrere von ihnen täglich. Um einen Eindruck von der Marktmacht der „Big 5“ zu bekommen, hier ein paar Zahlen: 2023 erwirtschafteten sie gemeinsam einen Gewinn von 1,6 Billionen Dollar (1,41 Billionen Euro), das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt Spaniens. Den größten Nettogewinn erzielte Apple mit 3.074 Dollar pro Sekunde, auf Platz 5 rangiert Amazon mit „nur“ 636 Dollar pro Sekunde. Laut einer Erhebung der niederländischen NGO SOMO übernahmen die „Big Five“ zwischen 2019 und 2025 mindestens 191 andere Unternehmen, also eines alle elf Tage.
Nicht nur entgehen Staaten dadurch Milliarden an Steuern, auch kleinere und mittlere Unternehmen in der Branche haben kaum eine Chance, sich am Markt zu etablieren. Das ist auch demokratiepolitisch höchst problematisch.
Die meisten von uns nutzen als Suchmaschine Google, bestellen Bücher auf Amazon und connecten auf Facebook oder Whatsapp mit Freund:innen. Rund die Hälfte des digitalen Traffics spielt sich mittlerweile auf den Servern einiger weniger Internetgiganten ab. Das bedeutet auch: Die „Big 5“ entscheiden, was wir lesen, welche politischen Meinungen wir in den Feed gespielt und welche Suchergebnisse wir angezeigt bekommen.
Das Gegenteil von Demokratie
Bis zum Ende des Jahrzehnts droht der digitale Diskurs völlig in die Hände privater Konzerne zu geraten, „das ist das Gegenteil von Demokratie“, warnte der Medienwissenschafter Martin Andree unlängst in einem Interview mit Arbeit & Wirtschaft.
Ein bekanntes Beispiel für den Einfluss von Milliardären auf die öffentliche Meinungsbildung ist auch die Plattform X, vormals Twitter. Durch die Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk verkam X zur Plattform für Bots, Hetzer, Rassist:innen und Verschwörungsideolog:innen. Frei nach dem Motto: Wer zahlt, schafft an, bastelte sich Musk eine Plattform nach seinen eigenen (politischen) Vorstellungen.
Globale Mindeststeuer
Ein Hebel, um gegen die Übermacht von Digitalkonzernen vorzugehen, ist, diese adäquat zu besteuern. Dass das keine leichte Aufgabe ist, weiß Martin Saringer von der Abteilung Steuerrecht der AK Wien: „Die Grundlagen der internationalen Konzernbesteuerung sind über 100 Jahre alt.“ Das bedeutet, sie stammen aus einer Zeit, in der Unternehmen meist in nur einem Land produzierten und in ebendiesem besteuert wurden. Heute ist der Besteuerungsprozess um ein Vielfaches komplexer, Konzernnetzwerke spannen sich über den ganzen Globus und Steuerbehörden haben ihre liebe Müh‘ und Not, dass diese Konzerngewinne besteuert werden.
Durch die zunehmende Globalisierung stehen Staaten untereinander im Wettbewerb. Regierungen, die Konzernen die günstigsten Konditionen anbieten, haben bessere Chancen auf einen Standort im eigenen Land – was steuerrechtliches „race to the bottom“ entfachte. Expert:innen sprechen in diesem Zusammenhang auch von „Regime Shopping“, Unternehmen lassen sich bevorzugt dort nieder, wo sie die geringsten Abgaben erwarten.
Da bei den Tech-Konzernen immaterielle Vermögenswerte, beispielsweise Patente, Lizenzen oder Warenzeichen, eine entscheidende Rolle spielen, „ist es für diese Konzerne relativ leicht möglich, ihre Gewinne dort hin zu verlagern, wo die Steuern niedrig sind“, erklärt Saringer.Dementsprechend mache es „wenig Sinn, wenn jeder Staat sein eigenes Digitalsteuer-Modell aufsetzt“. Was es brauche, seien EU-weite bzw. internationale Lösungen. Ein solcher Ansatz existiert, vor gut vier Jahren einigten sich 140 Staaten auf eine bisher einzigartige Steuerreform: Multinationale Konzerne mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro jährlich müssen zumindest 15 Prozent ihres Gewinns abführen – unabhängig vom Firmensitz. Praktisch aller EU-Mitglieder, Brasilien, Australien oder Katar haben die Steuer bereits eingeführt. Wirksam wurde sie mit 1. Jänner 2024, ob sie die Staaten auch tatsächlich einfordern, wird sich also noch zeigen.
Problemfall Irland
Das Problem: Die Konzernsitze der „Big 5“ befinden sich allesamt in den USA und Präsident Donald Trump ist bekanntlich weder Fan von Steuern noch von internationalen Vereinbarungen. Zu Jahresanfang kündigte er die Teilnahme der USA an der globalen Mindeststeuer wieder auf.
Genau das, so Saringer, könnte die EU zum Anlass nehmen, eine eigene Digitalsteuer zu etablieren. Überlegungen in diese Richtung gab es bereits 2018, diese wurden jedoch fallen gelassen, auch wegen der globalen Mindeststeuer. Scheitern könnte eine europäische Digitalsteuer auch am Einstimmigkeitsprinzip der EU in Steuerfragen. Insbesondere Irland, das für niedrige Gewinnsteuern bekannt ist und wo – wohl nicht zufällig – Meta, Alphabet, Microsoft und Apple ihren Europasitz haben, zeigte in der Vergangenheit wenig Bereitschaft. Der finanzielle Anreiz für die EU-Mitgliedsstaaten aber dürfte groß sein: Laut einer Studie des EU-Think Tanks CEPS würde eine Digitalsteuer von nur fünf Prozent den Mitgliedsstaaten gut 37 Milliarden Euro jährlich einbringen. Also immerhin 117 Euro pro Sekunde.
Die „Big 5“ und die Arbeitswelt
Auch auf die Arbeitswelt haben die „Big 5“ erhebliche Auswirkungen. Egal ob Personalerfassung, die Organisation von Arbeitsabläufen oder Programmierung: „Vor allem an Microsoft führt für die meisten Arbeitnehmer:innen in Österreich kaum ein Weg vorbei“, erklärt Clara Fritsch von der Abteilung Arbeit und Technik der GPA. Da Microsoft keine speziell auf den Betrieb angepasste Version liefert, sondern nur das Komplettpaket anbietet, obliegt es einem Unternehmen, welche Anwendungen sie verwenden.
Für Beschäftigte bedeutet das, dass zumindest potentiell ihre Privatsphäre in Gefahr ist oder ihre Leistung penibel kontrolliert wird. Arbeitnehmer:innen rät Fritsch unbedingt zu einer Betriebsvereinbarung: „Es braucht klare Regeln, eine Zweckbestimmung und eine:n Ansprechpartner:in“, beispielsweise einen Betriebsrat. Bei Updates oder der Einführung neuer Softwaren müsse die Betriebsvereinbarung regelmäßig angepasst werden, rät Fritsch.