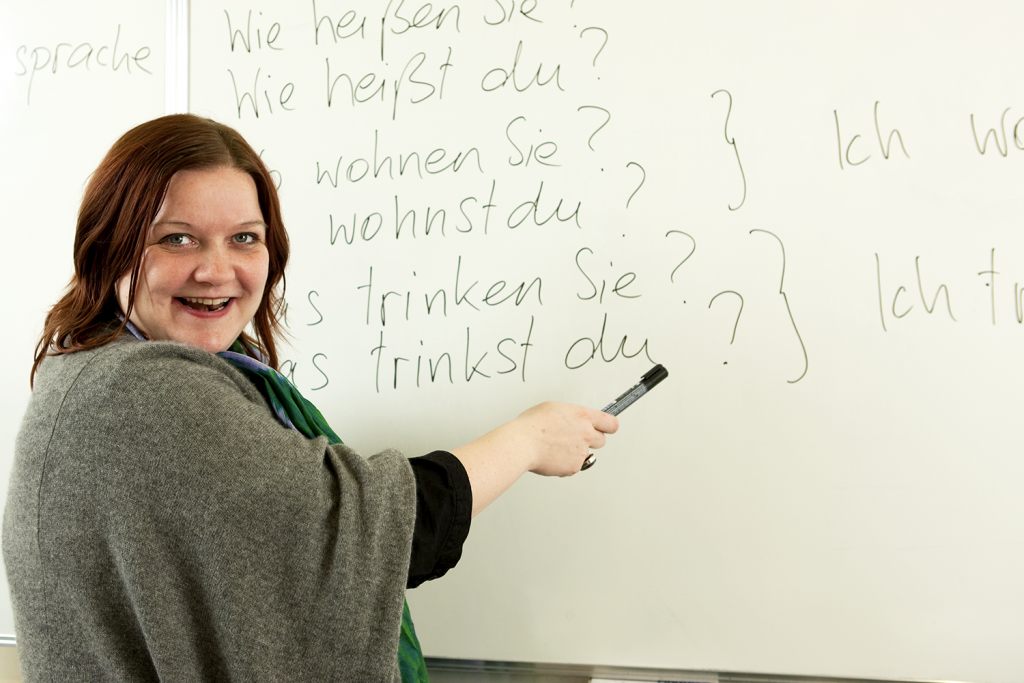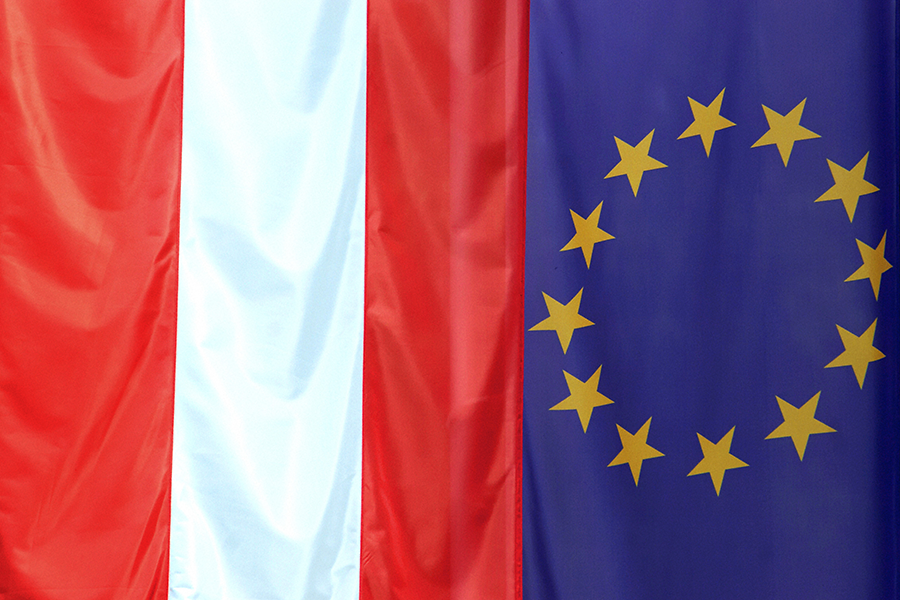
Wirtschaftskrise. Reichen der Euro-Rettungsschirm und eine radikale Sparpolitik aus, um Europa wieder flott zu machen? Wer trägt die Schuld an der Krise, wer zahlt die Zeche? Eine kritische Bewertung der europäischen Wirtschaftspolitik in fünf Fragen und Antworten.
Dieser Beitrag ist die Langfassung der Coverstory der KOMPETENZ 01/2011 „Wohin geht Europa?“.
Europa hat massive Probleme: einerseits ist es manchen Euro-Ländern unmöglich, sich auf den Finanzmärkten Geld zu leihen. Griechenland und Irland müssen sich daher Geld von anderen Mitgliedsstaaten borgen. Portugal und Spanien könnten in dieselbe Situation kommen. Andererseits gibt es enorme Unterschiede in der Stärke und Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder. Aus der Misere können Europa und alle Beteiligten nur dann kommen, wenn sich alle an der Lösung beteiligen. Die Schuld einfach den südlichen Mitgliedsstaaten zu geben verschärft die Situation und führt in eine Sackgasse.
Warum ein Euro-Rettungsfonds ?
Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben einen „Rettungsschirm“ aufgespannt, der derzeit mit insgesamt 750 Mrd. Euro die Zahlungsfähigkeit der Euro-Länder garantieren soll. Der Rettungsfonds hilft Ländern, die auf den Finanzmärkten zu vernünftigen Bedingungen kein Geld mehr bekommen und sorgt dafür, dass sich die Staaten weiter finanzieren können. Der Rettungsfonds bedeutet also nicht, dass Geld hergeschenkt wird, sondern die aufgenommenen Mittel müssen verzinst wieder zurückgezahlt werden. Das Geld aus dem Rettungsfonds kommt von EU-Staaten und dem Internationalen Währungsfonds. Irland muss 5,8 Prozent Zinsen zahlen, Griechenland für 3-jährige Kredite 5 Prozent.
Wer profitiert davon, dass die Zahlungsfähigkeit der betroffenen Länder erhalten bleibt? Viele Banken aus Deutschland, die Griechenland Geld geborgt haben. Gäbe es keinen Rettungsschirm für Griechenland, Irland und Co., hätte das weitere Bankenzusammenbrüche in Deutschland, England und anderen Ländern zur Folge. Dann müssten diese Staaten wieder Steuergelder in die Hand nehmen, um das eigene Finanzsystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Beim Rettungsfonds geht es also nicht nur um Solidarität, sondern auch um die Eigeninteressen der Geberländer. Letztlich haftet nun die Bevölkerung für die Forderungen der Banken und Vermögensbesitzer, weil es keine Beteiligung der privaten Gläubiger gibt. Diese ist allenfalls nach 2013 für neue Anleihen möglich.
Warum brauchen die Länder den Rettungsfonds?
Weil sie sich auf den Finanzmärkten nur noch gegen astronomische Zinsen verschulden können. Bei Rettungsfonds borgt sich ein Land Geld von anderen EU-Staaten anstatt seine Anleihen auf den Finanzmärkten an Banken, Versicherungen und Pensionsfonds zu verkaufen. Griechenland muss für 10-jährige Anleihen am Markt 12 Prozent Zinsen zahlen, Deutschland hingegen nur 3 Prozent. Also ist es sinnvoll, dass Länder mit guter Bonität Geld aufnehmen und es an andere Länder „weiterborgen“. Dabei könnte Deutschland auch profitieren, weil Griechenland mehr an Zinsen für Darlehen aus dem Rettungsschirm zahlen muss als Deutschland, wenn es selbst Geld aufnimmt.
Bei 12 Prozent Zinsen zahlt man nach 10 Jahren mit Zinsen mehr als das doppelte der geliehenen Summe zurück. Die hohen Zinsen sollen das größere Risiko abgelten, dass ein Land am Ende der Laufzeit überhaupt in der Lage ist, das geliehene Geld zurückzuzahlen. Wenn jetzt der Rettungsschirm die Zahlungsfähigkeit der Euro-Länder erhält, dann kassieren die Investoren dabei aber astronomische Zinsen, während ihnen das Risiko von den europäischen SteuerzahlerInnen abgenommen wird. Die Zeche zahlt die griechische und irische Bevölkerung. Denn eine Bedingung dafür, dass ein Land Hilfe aus dem Rettungsschirm erhält, sind brutale soziale Einschnitte.
Ein Land, das sich nicht mehr auf den Finanzmärkten verschulden kann, gibt de facto seine Souveränität auf. Das Budget wird nicht mehr von den Regierungen bzw. Parlamenten gestaltet, sondern von der EU-Kommission und dem IWF. Und die fordern Privatisierungen, Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst, Rentenkürzungen und Einschnitte bei sozialen Leistungen. Da die enormen Sonderrenditen der Investoren nicht drastisch besteuert werden, ist das eine brutale Umverteilungsaktion von der Bevölkerung zu den Spekulanten. In den nächsten 3 Jahren muss Irland über 15 Milliarden Euro einsparen. Der gesetzliche Mindestlohn sowie Kindergeld und Sozialhilfe werden gekürzt.
Skandalöserweise hatten die starke Eingriffe in die Souveränität Irlands einen blinden Fleck: Die extrem niedrige Gewinnbesteuerung von 12,5 Prozent wird nicht angehoben. Das kommt vielen Konzernen wie Pfizer, Google und Facebook entgegen, die aus steuerlichen Gründen in Irland beheimatet sind.
Wäre ein Ausstieg aus der Euro-Zone eine Alternative?
Wenn jene Länder, die in Schwierigkeiten sind jetzt die Währungsunion verlassen, werden ihre Währungen abwerten. Das ist zwar einerseits gut für die Wirtschaft, weil sich damit die Exporte verbilligen und die Produkte wieder wettbewerbsfähiger werden. Andererseits haben sich die Länder in Euros verschuldet. Wenn eine neue nationale Währung gegenüber dem Euro abwertet, werden die Schulden noch einmal massiv teurer. Die Rückzahlung wird dann für einige unmöglich und sie würden die Bedienung der Schulden einstellen müssen. Dann kommen wieder die Banken unter Druck, die viele Staatsanleihen abschreiben müssten.
Der Rettungsschirm verschafft eine gewisse Atempause. Es ist aber trotzdem fraglich, ob es manche Staaten schaffen werden, ihre Schuldenlast zu tragen. WIFO-Chef Aiginger hält eine Entschuldung von Griechenland und Irland für notwendig. Denn wenn jahrelang nur gespart wird, verfallen die betroffenen Länder in eine Stagnationsphase. Aiginger: „Das bedarf eines Abkommens mit den Gläubigern sowie eines europäischen Beitrags. Jetzt sollte man danach trachten, dass die Konsolidierung kürzer ausfällt. Die lange Variante bedeutet ein verlorenes Jahrzehnt für Griechenland und Irland. Das kann auch nicht im Interesse von Deutschland und Österreich sein. Unsere Hilfe kann durchaus als Investition betrachtet werden.“[1]
Wie kommen die betroffenen Staaten aus dieser Krise wieder raus?
Fakt ist: In den Euro-Ländern gibt es riesige Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit. Und die müssen abgebaut werden, wenn die Staaten die gemeinsame Währung beibehalten wollen. Wenn ein Land eine eigene Währung hat und an Wettbewerbsfähigkeit verliert, kann es seine Währung abwerten. Die Importe werden dann teurer, während die eigenen exportierten Produkte billiger und konkurrenzfähiger werden. Diese Möglichkeit besteht in einer Währungsunion aber nicht.
Der Euro wird nur haltbar sein, wenn die Unterschiede abnehmen und sich alle Länder am Anpassungsprozess beteiligen. Bis jetzt ist die Kluft in der Euro-Zone aber größer geworden. Hier ein Blick auf die Entwicklungen der letzten 10 Jahre: Die Lohnstückkosten sind in der Euro-Zone seit 2000 insgesamt um 20,1 Prozent gestiegen.[2] In Griechenland stiegen die Lohnstückkosten um 37 Prozent, in Deutschland hingegen nur um 5,6 Prozent! Wenn Griechenland seine Wettbewerbsfähigkeit alleine auf den Schnitt der Euro-Zone bringen wollte, müssten die Löhne um 17 Prozent sinken oder die Produktivität enorm steigen. Es liegt auf der Hand, dass sich das die Bevölkerung nicht gefallen lassen wird und kann. Der Anpassungsprozess kann also nur gelingen, wenn er gemeinsam erfolgt. Deutschland und auch Österreich müssen daher danach trachten, das Wachstum nicht nur über steigende Exporte zu erreichen, sondern die inländische Kaufkraft – also die Löhne und Gehälter – stärker anzuheben.
Wenn man die Anpassungskosten einfach nur den südeuropäischen Ländern aufbürdet, müssten diese um mit Deutschland aufzuschließen die Lohnstückkosten um über 30 Prozent drücken. Das ist unmöglich und wäre nur durch eine brutale Politik gegen die Bevölkerung denkbar. Wer ernsthaft diesen Weg gehen will, setzt die Zukunft der EU und die Demokratie aufs Spiel.
Warum ist Deutschland an der Situation genauso beteiligt wie Griechenland?
Vor allem die Regierung Deutschlands und die Europäische Kommission pochen auf Sparanstrengungen und eine Verschärfung des Stabilitätspaktes der EU. Dieser sieht Grenzen für die öffentlichen Defizite vor. Das ist nicht hilfreich. Zum einen hat Deutschland in den Jahren vor der Krise auch laufend höhere Defizite gemacht als erlaubt war und ist nicht bestraft worden. Zum anderen versucht die deutsche Wirtschaft auf Kosten anderer zu wachsen. Wer permanent mehr durch eine mäßige Entwicklung der Löhne seine Marktanteile ausdehnt, macht das auf Kosten des Auslands. Deutschland ist sehr stolz, deutlich mehr zu exportieren als zu importieren. Das können aber nicht alle machen. Die Überschüsse der einen sind die Defizite der anderen. Deutschland hat die hohen Überschüsse nicht im Inland investiert sondern die im Ausland angelegt. Weil sich die Binnennachfrage in Deutschland so schwach entwickelt hat, wurde das Geld in Südeuropa angelegt. Das ist jetzt auch das Problem vieler deutscher Banken. Die Exportüberschüsse Deutschlands führten zu Kapitalexporten.
Extremes Sparen in den Defizitländern gefährdet den Sozialstaat und verlängert die Krise. Wenn jetzt alle versuchen aus der Schuldenkrise rauszusparen, wird in weiten Teilen der EU die Wirtschaftsleistung wieder zurückgehen. Damit wird es noch schwieriger, die Schulden abzubauen, weil bei sinkender Beschäftigung auch die Steuereinnahmen sinken. Damit die Defizitländer stärker über die Außenwirtschaft wachsen und ihre Handelsbilanzdefizite reduzieren können, muss in anderen Regionen der Welt die Binnennachfrage gestärkt werden. Es funktioniert schlichtweg nicht, dass die einen Länder die Defizite reduzieren ohne dass die anderen ihre Überschüsse auch zurückfahren.
Welches Entwicklungsmodell ist gescheitert?
Über Griechenland wird viel geredet, weil es mit falschen Defizitzahlen Einlass in die Währungsunion gefunden hat. Griechenland hat auch eine Reihe von Problemen, die gelöst werden müssen: der hohe Anteil der Schattenwirtschaft führt dazu, dass viel zu wenig Steuereinnahmen vorhanden sind. Griechenland gibt außerdem viel mehr Geld für Rüstung aus als die anderen EU-Staaten.
Aber neben Griechenland sind auch Irland und die baltischen Staaten massiv von der Krise betroffen. Diese Staaten galten bis vor kurzem als wirtschaftspolitische Musterländer.
Der Einbruch im Baltikum ist dramatisch: Die Arbeitslosigkeit ist auf 15 bis 20 Prozent gestiegen, das BIP brach um 15 Prozent ein. Der Boom in den Jahren zuvor war durch hohe Verschuldung und hohe Leistungsbilanzdefizite geprägt. Das zeigt, dass die Entwicklung alles andere als nachhaltig gewesen ist. Expertin Hella Engerer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Das Beispiel Baltikum zeigt, wie fragil eine Wachstumsstrategie ist, die in hohem Maß auf Kapitalzuflüsse aus dem Ausland setzt.“ Die hohe Auslandsverschuldung wurde v. a. zur Finanzierung der sehr hohen Leistungsbilanzdefizite verwendet. Eine Abwertung würde zwar die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, brächte aber die vielen FremdwährungskreditnehmerInnen enorm unter Druck. Kreditausfälle würden die Banken treffen, die v. a. in skandinavischem Besitz sind.
Die Wirtschaftspolitik setzte auf neoliberale Standardmaßnahmen: Es wurde liberalisiert und flexibilisiert, die Kündigungsfristen wurden gekürzt, Steuern drastisch gesenkt. Aber es mangelte an Investitionen in die Bildung und an einer strategischen Industriepolitik. Es zeigt sich, dass es für eine erfolgreiche wirtschaftspolitische Strategie eben nicht ausreicht, dass sich der Staat zurückzieht und möglichst geringe Steuern einhebt. Der Mangel an öffentlichen Investitionen gefährdet vielmehr die Wettbewerbsfähigkeit.
Das irische Wirtschaftswachstum beruht maßgeblich auch einem aufgeblähten Finanzsektor und auf in diese Länder verschobenen Gewinnen. Im System der Wettbewerbsstaaten versuchte sich Irland durch Steuerdumping und Attraktivität für Investoren zu positionieren. Zahlreiche Konzerne versteuern ihren Gewinn günstig in Irland und setzen das Geld aber woanders wieder ein. Dies setzte andere Staaten unter Druck. In Irland hat die Regierung durch neue Steuererleichterungen Konsum und Konjunktur zusätzlich angeheizt. Es wurde enorm viel Kapital in Immobilienprojekte investiert. Diese erwiesen sich allerdings bei sinkenden Immobilienpreisen als Milliardengrab. Der Immobilienbereich blähte sich auf 20 Prozent der irischen Wirtschaftsleistung auf. Nach dem Platzen der Blase sanken die Immobilienpreise um 50 Prozent. Zuvor lockten niedrige Zinsen zum Schulden machen.
Die Notwendigkeit für Mindeststeuern im Unternehmensbereich wird offensichtlich, wenn jetzt die EU-SteuerzahlerInnen für Garantien des irischen Staates für die gefährdeten Banken bürgen müssen.
Was ist aus gewerkschaftlicher Sicht zu tun?
Die Finanzkrise, die aufgrund extrem riskanter Spekulationen privater Banken, Investmentbanken und Hedge Fonds entstanden ist, führt nun zu einer Verschuldungskrise der Staaten. Die Staaten haben die Finanzmärkte gerettet und werden nun von den Finanzmärkten für ihre hohen Schulden mit astronomischen Zinsen bestraft. Der Abbau der Schulden erfolgt in vielen Ländern durch einen rabiaten Angriff auf den Lebensstandard der Bevölkerung. Kürzung der Mindestlöhne, Kürzung der Unterstützung für sozial Schwache, für Familien, für Arbeitslose und für öffentlich Beschäftigten halten her für eine Rettung der Vermögenswerte jener, die ihr Geld in „geretteten“ Banken halten. Dass hier etwas falsch läuft liegt auf der Hand. Die Frage ist, wie lange sich das die Menschen gefallen lassen. Die breite Bevölkerung wird für die verheerenden Auswirkungen privater Fehlentscheidungen zur Kasse gebeten. Nur ein Kurswechsel kann einen Ausweg liefern. Die Verschärfung der Sparpolitik führt hingegen in eine Sackgasse.
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind folgende Maßnahmen notwendig:
Eine Regulierung der Finanzmärkte und eine Trennung der Kernbankgeschäfte von riskantem Investmentbanking.
Keine Geschäfte mit Steueroasen – dass die geretteten Banken die Gesellschaft durch Geschäfte in Steuerparadiesen schädigen, ist ein Skandal, der abgeschafft werden muss!
Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Damit wird Spekulation besteuert und teilweise reduziert. Es könnten dringend benötigte Mittel lukriert werden um die öffentlichen Schulden wieder abzubauen.
Eine Besteuerung der hohen Zinsen von Staatsanleihen, wenn das Risiko durch Rettungsschirm öffentlich getragen wird.
Steuerharmonisierung statt Kaputtsparen und Steuerdumping. 25 Prozent Mindestgewinnbesteuerung bei einheitlicher Bemessungsgrundlage. Nicht Ländern mit zu hohen Defiziten sind EU-Mittel zu streichen, sondern jenen, die durch Steuerdumping die Einnahmen der Staaten gefährden.
Mehr dazu
Bontrup: „Durch Umverteilung von unten nach oben in die Krise„